Die verklärten Welten eines Literaturwissenschafters und ein wohl unnötiger Forschungsgegenstand. Eine Dystopie mit der Sehnsucht nach dem 19. Jahrhundert.
Im Jahr 2119: Die Welt ist überschwemmt, Europa eine Insellandschaft, Freiheit und Reichtum unserer Gegenwart – ein ferner Traum. Der Literatur -wissenschaftler Thomas Metcalfe sucht ein verschollenes Gedicht von Weltrang. Der Dichter Francis Blundy hat es 2014 seiner Frau Vivien gewidmet und nur ein einziges Mal vorgetragen. In all den Spuren, die das berühmte Paar hinterlassen hat, stößt Thomas auf eine geheime Liebe, aber auch auf ein Verbrechen. Ian McEwan entwirft meisterhaft eine zukünftige Welt, in der nicht alles verloren ist. (Klappentext)
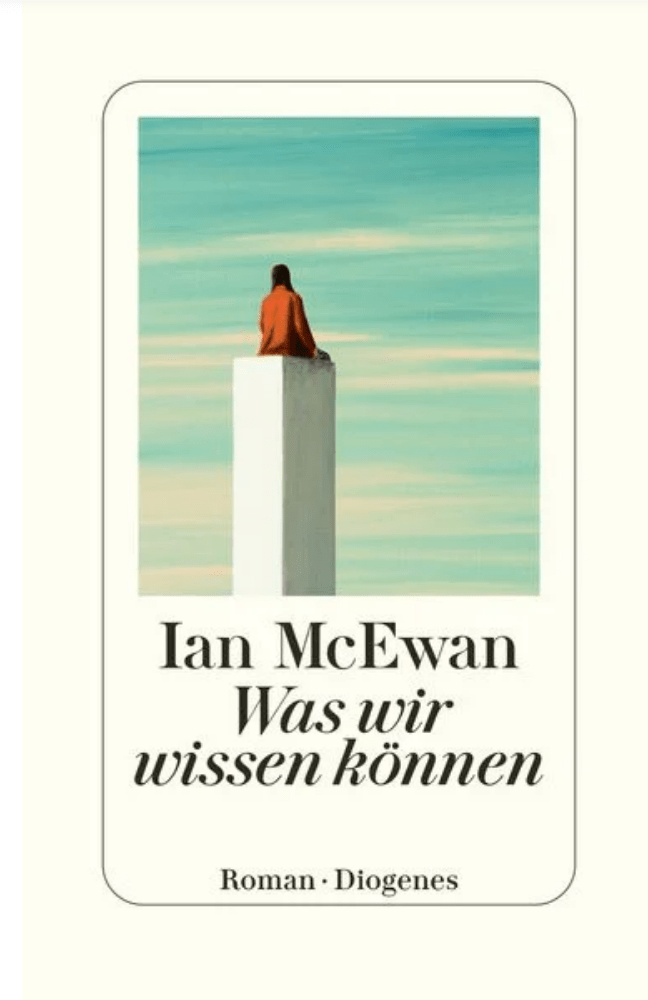
Buchtitel: Was wir wissen können
Autor: Ian McEwan
Erscheinungsjahr: 2025
Sprache: Deutsch
Übersetzung aus dem Englischen: Bernhard Robben
Verlag: Diogenes
Seiten: 480
ISBN 978-3-257-07357-7
Originaltitel: What we can know
Erscheinungsjahr Original: 2025
Buchbesprechung
Hanebüchen
Hanebüchen, denke ich, als ich lese, wie ein Literaturwissenschafter in den Zehnerjahren des 22. Jahrhunderts ausgerechnet einem verschollenen Sonettenkranz (sic!) eines arroganten Dichters aus unserer Gegenwart hinterherläuft. Verstörend auch, dass seine Student*innen sich weigern, an unserer Gegenwart wissenschaftliches Interesse zu entwickeln. Und ein wenig dahin geschlampt, wie der Ich-Erzähler die globale Katastrophe in der Mitte unseres Jahrhunderts schildert: mehr Schlagworte als umsichtige Beschreibungen. Auch die handelnden Personen sind keine Sympathieträger, weder jene in der Gegenwart, noch in der dystopischen Zukunft. Ich lese das Buch trotzdem Ende und lese es danach, weil ich meinem vorläufigen Urteil misstraue, nochmals in Auszügen. Doch Halt, eines nach dem Anderen!
Der Blick zurück
Vielleicht ein wenig Inhaltliches: Wir befinden uns im Jahr 2119. Eine von einer KI fehlgeleitete Atombombe ist 2042 im Atlantik explodiert, hat eine riesige Flutwelle ausgelöst und das Klima weltweit auf den Kopf gestellt. England ist größtenteils überschwemmt und gleicht einer Insellandschaft. Doch all das ist schon ein Menschenleben her und interessiert nur mehr wenige. So lebt man im Kreis von Philolog*innen genügsam und vom Weltgeschehen isoliert, ein friedvolles, wenn auch bescheidenen Leben. Der Ich-Erzähler räsoniert:
In unserer Zeit sind wir daran gewohnt, dass sich über Generationen hinweg nicht viel ändert. Wir nähern uns der Stasi der Prämoderne, in der Kinder davon ausgehen dürfen, das Leben ihrer Eltern und Großeltern zu führen. Unsere relative Isolation hat eine Art Frieden erzwungen, den manche, wie auch ich, für Stagnation halten.
Und wo sind die Anderen?
Der Literaturwissenschafter Thomas Metcalfe hat sich auf die Entdeckung eines Langgedichtes aus der Vergangenheit spezialisiert. Er reist von Insel zu Insel – die Bibliotheken wurden mit ihren Beständen im Zuge der Überflutung des Landes auf Hügel verlegt -, um die Archive nach Hinweisen zu seinem Projekt zu durchforsten. Es geht um die Entdeckung eines Sonettenkranzes, der im Rahmen einer Geburtstagsfeier für die Gattin des Autors Francis Blundy von ihm höchstpersönlich erdichtet, auf Leder niedergeschrieben, rezitiert und feierlich an seine Gattin überreicht wurde. Aber selbst die Medien der Zukunft betrachten ein derartiges Werk spöttisch als Anachronismus in der Literatur des 21. Jahrhunderts. Das Gedicht ist inzwischen verschollen, niemand weiß um seinen Aufenthaltsort oder seine genauen Inhalte. Auch die Leser*innen wissen nicht, warum sie es eigentlich entdecken sollten. Es beginnt nun eine Schatzsuche, der Thomas in obsessiver Weise nachkommt. Er durchforstet die Archive und elektronischen Hinterlassenschaften, der in dieser Geburtstagsfeier anwesenden Personen (Dichter, Verleger, Literaturwissenschafter) auf Hinweise zum Verbleib des Gedichts. Auch seine Frau Susi forscht zur Literatur unserer Zeit: Sie verfasst eine „Monografie zur Realismuskrise in der Literatur 2015 – 2030“. An der Universität halten beide einen Kurs zur „Politik und Literatur der Überflutung.“ Sie sind unserer Gegenwart sehr verbunden, auch wenn dies dem Zeitgeist widerspricht.
Wollen wir das alles wissen?
Der Leser hat indessen langsam begriffen, warum das gegenständliche Buch den Titel „Was wir wissen können“ trägt. Geschichte war schon immer ungenau, nie mehr als nur eine Annäherung an die Wahrheit. Es geht immerhin auch um Erkenntnisinteressen und Obsessionen von Forschern. Nach Ansicht von Thomas ist unser Zeitalter von einer tief gehenden geistigen wie klimatischen Disruption geprägt. Doch er geht weiter, begibt sich in die Niederungen der privaten Angelegenheiten handelnder Personen: Er erforscht Alzheimer, eheliche Untreue, intellektuelle Anmaßung, klimabezogene Ignoranz und persönliche Schuld. Das führt mich zu einer Replik auf den Titel des Buches: Wollen wir das wirklich alles wissen? Wollen wir uns wirklich auf die Befindlichkeiten einer faden und abgeklärten Elite einlassen?
Hätte der Autor mehr und sorgfältiger über die von ihm behauptete Disruption unserer Zeit nachgedacht, mehr über den gegenwärtigen Literaturbetrieb und das Leben abseits der von ihm errichteten ländlichen Idyllen, nun, dieses Buch hätte interessant werden können. Stattdessen quält er die Leser*innen mit atmosphärischen Schilderungen, die aus dem gesellschaftlichen Leben des 19. Jahrhunderts stammen könnten. Ist das wirklich alles, was der forschende Geist über die Vergangenheit unserer Gegenwart erfassen kann? Hatten wir den keine relevante Literatur zu feiern und mussten uns mit verlogener Poesie von Klimaleugnern begnügen? Waren wir derart von Nostalgie und Redundanz befallen, wie es uns der Autor einzureden versucht?
Auch die Schilderung des 22. Jahrhunderts bleibt seltsam blutleer: eine blasse Kollegin und Lebensgefährtin; klischeehafte Überlegungen zur künstlichen Intelligenz der Zukunft; die Internethochburg Nigeria; protestierende Studentinnen, die sich lieber der Zukunft widmen wollen als den Hirngespinsten zweiter Literaturwissenschafter*innen. Dazu Ingredienzen einer körperlich anstrengenden Schatzsuche im verwilderten Gelände einer verbotenen Insel. Am Ende werden wir mit einem im Großen und Ganzen uninteressanten Tagebuch der schon lange verstorbenen Vivien Bundy gelangweilt. Eine Hommage an die Fernliebe eines verkappten Literaturwissenschafters?
Resümee
Trotz der sich im Buch ausbreitenden Langeweile bleibt auf das große erzählerische Geschick des Autors hinzuweisen. Beeindruckend, wie er die Handlungsstränge entwickelt und als Erzähler wissend und mit sorgfältigen Hinweisen die Geschichte zur Auflösung bringt. Überraschend originell und zwingend logisch auch das Ende des Romans. Mitten drin auch eine großartige Schilderung des Erlebens der Alzheimer-Krankheit, daneben Seiten stiller und schöner Prosa. Wäre das Buch nicht besser geworden, hätte es 200 Seiten weniger?
Ergänzendes:
- Rezensionshinweise auf Perlentaucher
- Kauf im Faltershop

Hinterlasse einen Kommentar