Stellen Sie sich vor, eine Katastrophe hat die Menschheit ausgelöscht, bis auf eine Handvoll Überlebender. Darunter Jola, Anfang 20. Mit einer kleinen Gruppe etwa Gleichaltriger findet sie Zuflucht in einem leerstehenden Hotel. Ihre Tage sind mit Fragen des reinen Überlebens gefüllt, der Suche nach Lebensmitteln und Waffen, aber auch damit, bei Verstand zu bleiben. Kinder werden allmählich geboren, wie in einer Patchwork-Familie haben sie mehrere Mamas und Papas. Zunehmend fällt es Jola und den anderen schwer, sich damit abzufinden, dass es „dort draußen“ niemanden mehr geben soll. So beschließen sie, einen von ihnen zu einer Mission in die Welt hinauszuschicken – mit unerwarteten Folgen… In ihrem geschickt zwischen den Zeitebenen jonglierenden Roman schildert Johanna Grillmayer die Neuorganisation des Lebens nach der großen Tabula rasa: Wie schießt man einen Rehbock? Und wie zerlegt man ihn? Worin die Kinder unterrichten? Wie eine Gesellschaft etablieren? Das liest sich spannend wie ein Krimi, obwohl oder gerade weil der Roman ohne postapokalyptische Action- und Horrorszenarien auskommt. „That‘s life in Dystopia“, lautet das lakonische Resümee einer der Überlebenden. Warum also nicht die Stunde Null als Chance sehen, die Dystopie als Utopie?
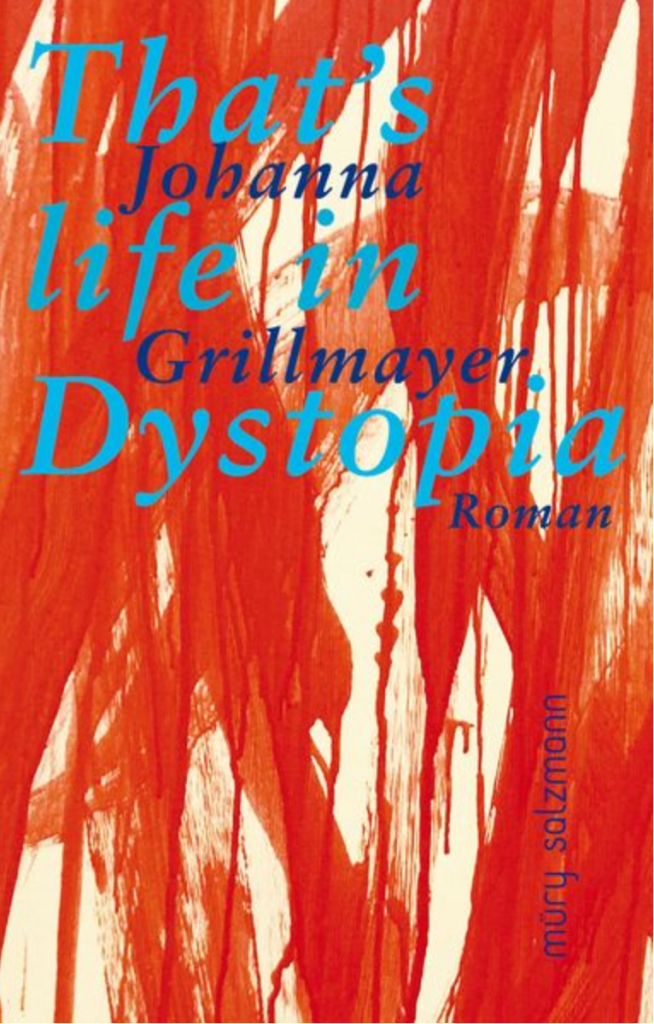
Buchtitel: That’s Life in Dystopia
Autorin: Johanna Grillmayer
Erscheinungsjahr: 2023
Sprache: Deutsch
Verlag: Müry Salzmann
Seiten: 432
ISBN 978-3-99014-246-2
Rezension:
Mit einem Knalleffekt beginnt die österreichische Journalistin und Schriftstellerin Johanna Grillmayer ihr Buch. Vor dem ehemaligen Hotel, das zum Zufluchtsort ihrer Bezugsgruppe geworden ist, erschiesst die Protagonistin des Romans, Jola, einen unbekannten Mann in Lederjacke, der ihre Freundin Ali zu vergewaltigen droht. Das Gewehr ist schnell zur Hand. Es liegt geladen und jederzeit verfügbar in einem Schrank. Sie handelt ohne Zögern. Um keinen weiteren Schuss abgeben zu müssen, lässt Jola den Mann verbluten. Sie will die Kinder im Haus nicht weiter beunruhigen. Danach versenkt sie mit einem Mitbewohner die Leiche des Aggressors im Fluss und wendet sich wieder den Routinen ihres neuen Lebens zu.
Die weitere Entwicklung eines Lebens in der Dystopie ist weniger spektakulär. Der Schuss auf den Eindringling war eben nur kühl kalkuliertes Anfangskapitel, um der Aufmerksamkeit der Leser*innen habhaft zu werden und sie gleich im nächsten Zug zu enttäuschen: denn das war eines der raren Szenen apokalyptischer Gewalt. Noch einmal, gegen Ende des Buches, wird die Erzählerin dieses Thema wieder aufgreifen. Man weiss aber nicht so recht, warum. Apokalypse interessiert die Erzählerin nur am Rande. Vielmehr geht es ihr um die Bedingungen und Routinen des Überlebens, die folgende Fragen behandeln: Wie wäre es, wenn der Mensch wieder von Vorne beginnen könnte? Welche Formen des Zusammenlebens, welche Utopien sind in einer Dystopie möglich? Diesen Fragen will der Roman nachgehen.
Eine Gruppe junger Menschen um die Dreissig ist es gelungen, die grosse Katastrophe zu überleben, die die Menschheit überraschend und ohne begreifbare Ursache hingerafft hat. Von der gängigen Erwartungshaltung, das dies mit der Klimakatastrophe oder einem Nuklearkrieg zusammen hänge, keine Spur. Die Erklärung ist überraschend und ein wenig lustlos: Die Mehrheit der Menschen hätten sich einfach „in Luft aufgelöst“ (sic!), sie sei binnen kurzer Zeit aus dieser Welt verschwunden und hätte ihre Besitztümer und Errungenschaften unversehrt zurückgelassen. Das ist praktisch für die aufkeimende Utopie, weil eine derarige Hinterlassenschaft das Ressourcenproblem löst. Nur hie und da treffen die wenigen Überlebenden auf verwesende Menschen und Tierkörper, meist vom Danach ums Leben gebracht. Von den Ursachen und den Ausmassen der Katastrophe erfahren wir in diesem Buch wenig. Die Betroffenen sprechen nur sehr verhalten von der „Auslöschung“ der Menschheit, umschiffen das Ereignis lieber mit den vorsichtigen Umschreibungen von Davor und Danach. Überleben konnte die Gruppe, die der Roman ins Zentrum stellt, nur deshalb, weil sie sich angesichts der Katastrophe in einen Weinkeller hatte retten konnten. Also doch „etwas mit Strahlung“, vor dem die in die Erde gebauten Keller geschützt haben? Darüber kann freilich nur spekuliert werden.
Das Verschwinden der Bevölkerung macht den erzählerischen Weg frei für eine Welt, in der sich eine konstruktiv – positive Zukunft bewähren kann. An lästigem Ballast aus dem „vorherigen“ Leben schleppen die Protagonist*innen erstaunlich wenig mit sich. Selbst eine versuchte Vergewaltigung im Zufluchtsort Weinkeller lässt die Protagonistin Jola erstaunlich unbeschadet zurück. Auch die abrupte Trennung von Familie und Freunden, ja ihr wahrscheinlicher Tod, ist nur ein Thema am Rande. Trauer um das Vergangene will mensch sich nicht leisten, Einsamkeit ist im Setting dieser Überlebensgemeinschaft nur Schwäche, die den Normen der Gruppe widerspricht. Nur Jakob, einer der Männer der Gemeinschaft, ist anders: er kann nicht anders, als ständig an die Ereignisse von damals und das Davor zu denken. Er ist begreiflicherweise deprimiert und macht sich Gedanken darüber, was zu tun sei, wenn die Ressourcen, von denen sich die Gruppe bedient, einmal ausgehen sollten. Jakob ist ein stiller Grübler, ein Aussenseiter.
So bleibt die Erzählerin fast den ganzen Roman damit beschäftigt, eine Mikrogesellschaft darzustellen, die mitunter stark an aktuelle Prepperfantasien und häufig strapazierte Aussteiger-Erzählungen orientiert ist. Die Gruppe hat sich in einem leerstehenden Hotel im hügeligen Niederösterreich einquartiert und baut rund um dieses eine funktionierende Subsistent-Landwirtschaft auf. Sie, die in ihren Leben vor der Auslöschung „brotlose“ Berufe gelernt haben, erzeugen nun ihre Nahrungsmittel selbst. Sogar Servietten besitzt man aus dem Fundus des Hotels. Kräuter baut man an, um notwendige Arzneimittel zu gewinnen. Mangels Maschinen und Treibstoff kehrt mensch teilweise zur Handarbeit zurück. Kinder werden geboren, eben weil man nach der Katastrophe an die Zukunft glauben will und Verhütungsmittel rar werden. Die Kinder werden zu Hause beschult, sind begierig zu lernen und bezeichnen anwesenden Männer unterschiedslos als Papas. Das Überleben wird organisiert in einer recht gut funktionierenden Gemeinschaft. Mensch ist aufeinander angewiesen, und man kennt sich ja von “vorher“.
Wir sehen schon: Das Gefahr aufkommender Klischees ist gross und lässt die Geschichte sehr rasch ins Redundante abrutschen. Konfliktstoff und psychologischer Tiefgang sind rar. Die Leserinnen kommen nicht umhin, sich an die Lebensweisen von Hippie – Landkommunen zu erinnern: Behaupteter Egalitarismus, verdeckte, informelle Hierarchien, primitive Landwirtschaft, exzessive Diskussionskultur und Promiskuität bestimmen die Existenz. Insgesamt wird ein Leben in Subsistenzwirtschaft mit immer knapper werdenden Ressourcen beschrieben. Die handelnden Personen stellen Sammler*innen und Jäger*innen auf dem Weg zur Agrarkultur dar. Die Ambition der Romanfiguren aber ist gross: es herrscht unerschütterlicher Optimismus. Das mutet an wie naiver Solarpunk, befände man sich technologisch nicht so weit in der Vergangenheit. Das zur Verfügung stehende Reservoir an Waren schafft zunächst noch genügend Spielraum, um sich Kenntnisse und Fertigkeiten anzueignen, mit der die Zukunft bewältigt werden kann. Von einem Kampf ums Überleben kann mensch daher kaum sprechen. Auch die Energiefragen sind grundsätzlich geklärt (Wind- und Sonnenenergie!), benötigen aber Instandhaltung. Die medizinische Versorgung sichern ein trunksüchtiger Arzt und eine migrantische Krankenschwester in unmittelbarer Nachbarschaft. Streusiedlungen, die scheinen zum Überleben zu reichen.
Das Leben bleibt in der Privatheit einer Kommune stecken, die wortreich von der Erzählerin beschrieben und verklärt wird. In den ersten zwei Dritteln des Buches geht es hauptsächlich um die Verhandlung des Sozialen in einer Grossfamilie, in der die beiden Frauen Lola und Ali das Sagen haben und ihre Maßstäbe setzen. Männer sind meist nur tollpatschig im Wege, bedienen Maschinen, bringen die wachsende Kinderschar zu Bett und sind verstört über die polyamourösen Verhältnisse, die die beiden Frauen lustbetont etablieren. Geliebt und gevögelt wird unter der Aufsicht der Frauen viel, Kinder gezeugt gerne. Diese haben folgerichtig eine Mama und viele Papas. Abseits des Narrativs von der freien Liebe bleibt aber die Frage unbeantwortet, wohin die ursprünglichenn Machtverhältnisse zwischen Mann und Frau verschwunden sind, in denen die Zukunftsfrohen einst sozialisiert wurden. Da hilft es auch nicht mit Verweis auf die Feministin Kate Miller zu verweisen, dass in diesem Buch eine neue Form der Sexualpolitik beschrieben wird (Johanna Lenhart, Literaturhaus Wien). Sex, Fortpflanzung und soziale Macht seien immer schon in dystopischer Literatur verhandelt worden, meint sie und nennt prominente Namen wie Margret Atwood. Nur: was tut man mit dem Rest von Vergangenheit?
Doch das wäre wohl zu viel an Sozialpsychologischem, das wie ein Klotz am Bein der versuchten Utopie zu hängen droht. Ähnlich geht das mit der Vergangenheit. Auch sie wird abgeschüttelt. Es scheint die Sonne im Hotel Sonnenhof. Dystopie darf nicht dystopisch sein. Die Verbindung zu der Vergangenheit und den Traditionen, die vor der Katastrophe geherrscht haben, ist gekappt. Kein Re-boot also, sondern Tabula Rasa. Vergangenheit steht dem Leben entgegen:
„Sie hätten ein winziger Epilog auf die Geschichte sein können, eine selbstvergessene, alle Vorräte konsumierende Nachhut der Menschheit“ Der Zerfall, die Zersetzung, der Rostnund Staub, die Fäulnis, der Schimmel, die Edelsteine und Stille – sie wären deren Verwalter gewesen.“
Gesellschaftliche Machtfragen und wirkmächtige Tradition bleiben aussen vor. Was politische und soziale Macht erst entstehen lässt, nämlich die Kontrolle über Produktionsmittel und die Durchsetzung von Ideologie, passiert in diesem Roman nicht. Einmal denkt man eine Schutztruppe an, die die weit von einander entfernt liegenden Siedlungen der Gutwilligen bewachen könnte. Ein anderes Mal eine Art übergeordnete Versammlung, bei der man sich abstimmen und gemeinsam planen könne. Nur ja nicht Politik wie Davor betreiben! Allein Demokratie und Menschenrechte möchte man erhalten und dazu braucht man Grundlagen, die es offenbar nur in Wien gibt. Was aber will der Mensch von dort holen? Die Verfassung, Parlamentsdokumente, eine gebundene Menschenrechtskonvention Gibt es die nicht auch in den Bibliotheken, die man sonst so gerne frequentiert, um sich Bücher über Landbau anzuschaffen?
„Es wird eine neue Gesellschaft aufgebaut“, schreit uns der Roman entgegen und viele seiner Buchkritiker*innen stimmen darin überein. Sie irren. In Wirklichkeit verliert sich der Roman in seiner Privatheit, zieht sich darin zurück, und erstickt die Utopie. Der österreichische Kabarettist Otto Grünmandl hatte einst am Einmann Stammtisch vor sich hin sinniert: „Politisch bin ich zwar ein Trottel, aber privat kenn ich mich aus.“ Diese Selbsterkenntnis hat auch heute noch ihre Gültigkeit.
So nimmt nicht wunder, dass die Begegnung mit Anderen, die ausserhalb des Sonnenhofs um ihr Überleben kämpfen, mit grosser Skepsis betrachtet wird. Menschen in Lederjacken streunen herum, legen ihre Kinder bei den Kommunarden ab ab oder drohen diesen mit Überfall und Raub. Auch den Nicht-Lederjacken, wie etwa den Pferdemännern, begegnet man mit Misstrauen. Dass wird noch dadurch befeuert, dass der Männerüberschuss gewaltig ist. Alle Mönner sind verdächtig, wenn sie am sexuellen Notstand leiden, Nur zögernd setzt sich die Einsicht durch, dass die Vergesellschaftung mit Anderen grosse Chancen bergen könnte.
Eingesperrt in der Privatheit des erzählerischen Kosmos ist man als Leser*in froh, wenn man nach routinierter Lust am heimischen Herd und geschwätzigen Dialogen auf einen Raubzüg zur Heranschaffung von Ressourcen mitgenommen wird, um so der aufkeimenden Langeweile einer Mini-Utopie zu entkommen. Man wünscht sich auch, dass der Lonesome Cowboy und Loverboy namens Marek endlich von seiner mehrjährigen Abwesenheit erzählt, zu der er einst aufgebrochen war, um das Land jenseits des heimischen Experiments zu erkunden. Erzählen darf er darüber nicht öffentlich, weil sonst die Heranwachsenden Schaden nehmen könnten. Wie wünschen wir uns doch, dass er erneut zu Abenteuern aufbreche, und davon erzählt wird! Wir sind es leid, im Hamsterrad sozialer Selbstbespiegelung mitzulaufen.
Am Ende steht die Fahrt nach Wien. Der Roman spannte seine eher stockende Handlung und überbordende Geschwätzigkeit über einen Zeitraum von acht Jahren. Die Zeit ist offenbar reif für die Aussenwelt. Erst kürzlich erschien der Folgeband. Er nennt sich „Ein sicherer Ort.“ Wir werden, wohl oder übel, auch davon zu erzählen wissen. Ob es ein anderer Ort sein wird?

Hinterlasse einen Kommentar